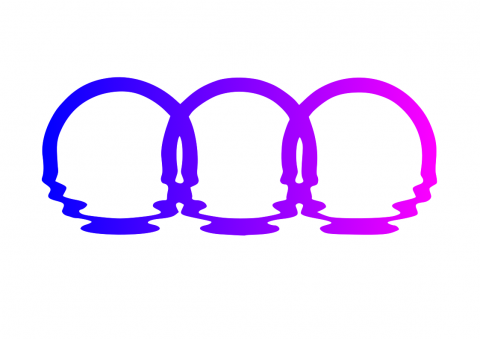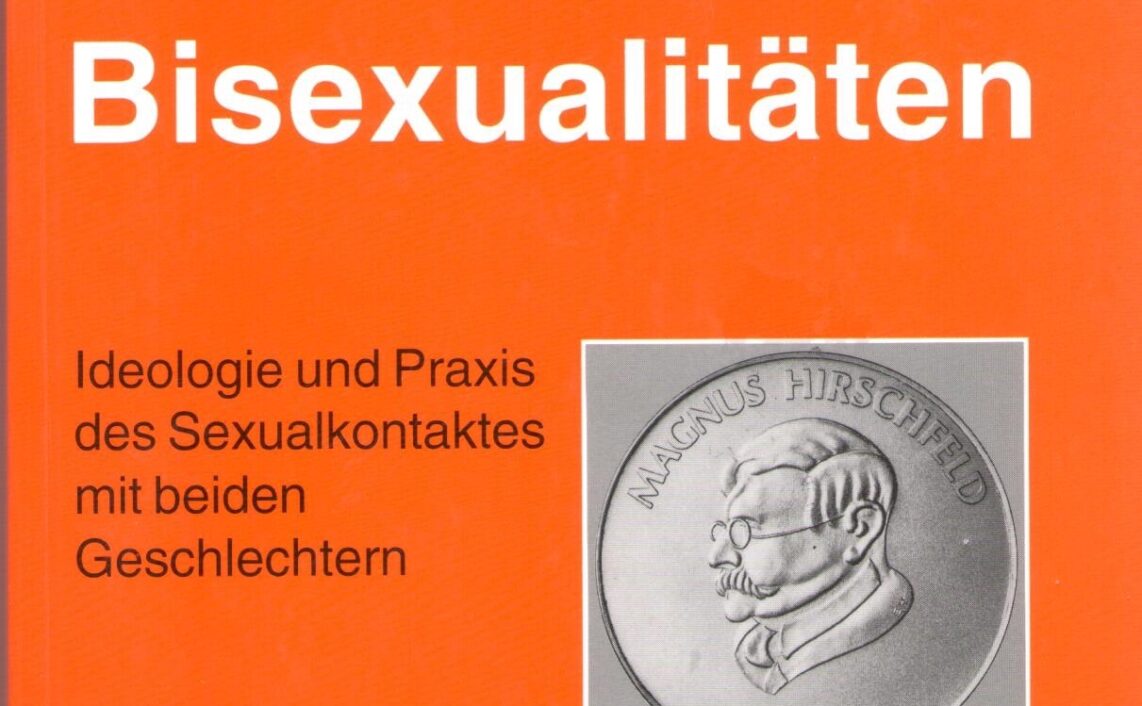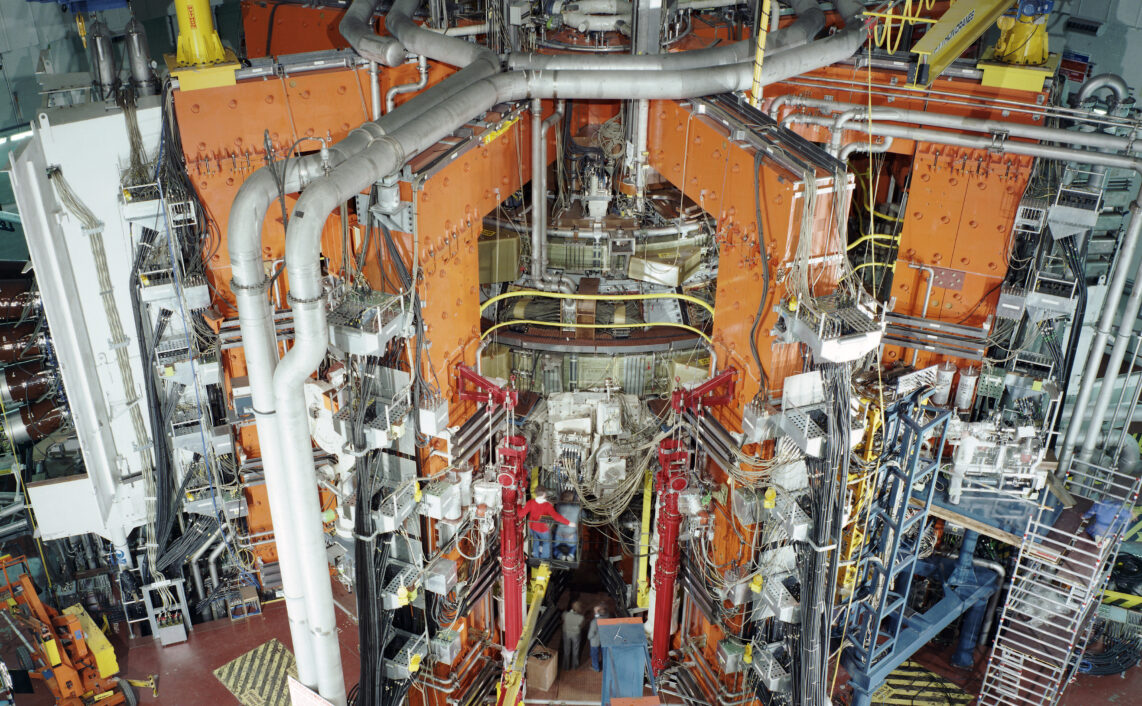Die Bilder im Kopf, die Geräusche, der Klang der Stimmen – all das sind Dinge, die das Lesen eines Buches zu einem ganz persönlichen Erlebnis machen. Mehr als einmal beging ich den Fehler, die Verfilmung eines zuvor gelesenen Romans im Kino anzusehen – was meine eigenen Bilder, Klänge und Stimmen in meinem Kopf zerstört und durch die Bilder und Synchronstimmen des Films “überschrieben” hatte. Seitdem meide ich Buchverfilmung, wenn ich das Buch schon gelesen habe – auch wenn die Verlockung z.B. bei 1984 oder Stadtgeschichten durchaus groß war.
Die eigenen Bilder, die beim Lesen entstehen, können aber auch in die Irre führen. Wenn Protagonist*innen sich langsam formen und ein Bild Kopf entsteht, das mit einem Wort schlagartig als falsch entlarvt wird. So dieser Tage mehrfach geschehen beim Lesen von Girl, Woman, Other der britischen Autorin Bernardine Evaristo. Prägnantestes Beispiel war die Lehrerin Mrs King. Das erste Kapitel, in dem sie auftauchte, beschrieb sie aus Sicht einer Schülerin, und in meinem Kopf entstand das Bild einer älteren, strengen, altmodischen und biederen Frau, die ganz selbstverständlich als weiß vor meinem inneren Auge entstand. In einem späteren Kapitel wird dann aus Mrs Kings eigener Perspektive erzählt, wie sie bei ihrer ersten Stelle als Lehrerin den Druck verspürte, nicht nur eine großartige Lehrerin, sondern auch eine Botschafterin für alle Schwarzen Menschen in der Welt sein zu müssen.
Dieses eine Wort “black” zerstörte nicht nur mein inneres Bild von Mrs King. Es entlarvte auch meine inneren Strukturen, die sie – ganz selbstverständlich – in meiner Vorstellung als weiß hat entstehen lassen. Und das obwohl durch die zuvor gelesenen Beschreibungen völlig klar war, dass es in diesem Buch ganz maßgeblich um Schwarze Frauen geht. Aber das Auftauchen von Mrs Smith als weitere Person in der Erzählung über eine Schwarze Schülerin machten sie nicht als zukünftige Protagonistin erkennbar – wodurch scheinbar eine Art “Default” in meinem Kopf zuschlug, der erstmal alle Menschen als weiß ansah, sofern nicht explizit anders benannt.
Interessante Erfahrung, und Lerneffekt über mich selbst.
Inhaltlich will ich über das Buch gar nicht viel mehr schreiben, das haben andere bereits gemacht, z.B. Gabriele von Arnim bei Deutschlandfunk Kultur oder Micha Frazer-Carroll im Guardian.
Was mich an den Buch ebenfalls fasziniert hat, war die Sprache. Aufmerksam geworden durch eine Veröffentlichungsmitteilung der deutschen Übersetzung in einem firmeninternen Newsletter, lud ich mir die Leseprobe – und war verwirrt bis enttäuscht. Sollte ein E-Book für 20 EUR wirklich so schlecht gemacht sein, dass nicht mal Interpunktion und Zeilenumbrüche in der elektronischen Ausgabe richtig dargestellt würden? Irgendwie sah das komisch aus, diese kurzen und längeren Absätze mit erratisch scheinenden Umbrüchen, ohne Satzzeichen davor und danach, meist mit Kleinbuchstaben beginnend, die durch die vielen Kommata und Substantivgroßschreibung im Deutschen ein extrem unruhiges Bild ergaben. Da sich die ersten Seiten auch sehr holprig, teilweise auch gekünstelt anfühlten beim Lesen, vermutete ich eine – wäre ja nicht das erste Mal – mäßige deutsche Übersetzung und versuchte es mit dem englischen Original.
Das war aber genauso gesetzt, jedoch durch die weitgehende Kleinschreibung und die deutlich geringere Komma-Häufigkeit im Englischen zumindest optisch nicht ganz so unruhig. Und als ich mich einließ darauf, wurde mir schnell klar, dass es so gewollt war. Lyrik-artig hörte die Zeilen dann auf, wenn sie zu Ende sein sollten und nicht wenn die Breite der Seite es erforderte. Jede Zeile – oder gar besser “Vers”? – egal wie kurz oder lang, floß und trug mich von einem Wort zum nächsten. Die Verse verlangten geradezu danach, gesprochen, nicht nur gelesen zu werden. Und je mehr ich – mehr oder weniger – laut las, desto häufiger bemerkte ich, dass in den gesprochenen Versen etwas mitschwang, das sich beim stillen Lesen zu verstecken schien. Auch wenn das Vokabular manchmal durchaus herausfordernd war. Bei den häufig auftauchenden umgangssprachlichen Vokabeln und Floskeln halfen Wörterbuch und Google – immer wieder verbunden mit der Frage, wie das überhaupt ins Deutsche übertragen werden könne, ohne allzu viel Gehalt zu verlieren.
Beim Schreiben dieser Worte schaue ich mehrmals auf die Übersetzung und vergleiche einige Stellen, in denen ich im Englischen genau jene Frage hatte. Vielleicht wäre die Übersetzung doch nicht so schlecht zu lesen gewesen, hätte ich mich auf sie genauso eingelassen wie auf das Original.
Cover-Foto © Klett-Cotta